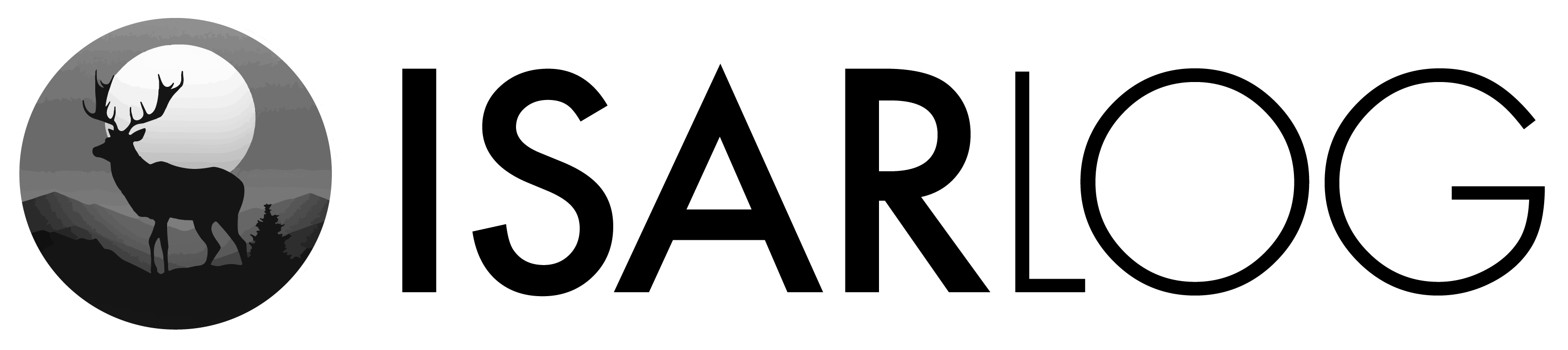Für mich gehört die Isar zu den schönsten Flusslandschaften Deutschlands. Dass ich mit dieser Meinung nicht allein bin, zeigen mir meine regelmäßigen Spaziergänge entlang des Flusses. Ich finde, wir Münchnerinnen und Münchner sind in einer besonders privilegierten Lage, einen Fluss mit einer derartigen Qualität und Artenvielfalt vor der Haustüre zu haben.
»Die Isar und deren tierische Bewohner werden zusehens einem hohen Stress ausgesetzt.«
Doch wie immer es mit der Liebe ist, kann einem zu viel auch erdrücken. Die Isar ist für uns Rückzugsort, der Platz, um Freunde zu treffen, ja auch mal zu feiern und natürlich, um zu baden. Und waren es vor einigen Jahren noch eine überschaubare Zahl an Menschen, steigt und steigt besonders die Anzahl der Sonnenbadenden in Richtung Stadtkern. Deswegen nenne ich die Plätze um Wittelsbacher- und Reichenbachbrücke den “Goldstrand Münchens”. Das mag auf den ersten Blick übertrieben klingen, überwiegt doch der Bierkonsum vor günstigem, hartem Alkohol. Doch mal davon abgesehen – und das gilt für alle Lieblingsplätze -, je mehr und öfter wir dort sein wollen, desto stärker werden diese strapaziert und die Isar und deren tierische Bewohner hohem Stress ausgesetzt.
Versuche wie die verstärkten Einsätze von Sicherheitspersonal und wachsenden Verboten sind Schritte, um der Masse entgegenzuwirken, doch ob diese Mittel auf Dauer alle glücklich machen? Warum also nicht verstärkt mit Aufklärung starten? Aufklären darüber, welche Artenvielfalt hier wirklich vorherrscht, dass der Fluss nicht einfach nur kaltes klares Wasser mit sich trägt, sondern zahlreiche Fischschwärme, Flusskrebse und andere Tiere. Natürlich kann man jetzt entgegensetzen, dass dieses Aufklärerische niemanden interessieren wird und von oben herab schon gar nicht. Wem will man es verdenken, wenn nach harter Arbeit Gruppen von Menschen dort den Abend ausklingen lassen wollen?
»Die Isar ein Wildfluss, kein ungefährlicher Bachlauf.«
Aufgeklärt wird heute schon, zum Beispiel über die zusehende Verunreinigung der Ufer in Form einer (Kino) Werbung mit der Bitte, den eigenen Müll mitzunehmen. Alternativ ihn dort zu platzieren, wo er auch abgeholt werden kann. Natürlich gibt es auch zahlreiche Informationstafeln über die Artenvielfalt. Diese werden aus unterschiedlichsten Gründen gerne ignoriert. Natürlich kann jeder selbstständig recherchieren und sich informieren, welch wunderbares Getier unter der Wasseroberfläche lebt. Doch ehrlich gesagt war es schon immer leichter, Informationen dorthin zu tragen, wo die Menschen sind, anstatt auf Informationseinholung zu hoffen.
Auch ich habe kein Patentrezept, aber ich versuche durch filmische und fotografische Mittel, die Isar emotional greifbarer zu machen. Für alle, die es wollen. Seit fünf Jahren besuche ich regelmäßig mir bekannte Stellen an der Isar, tauche unter Wasser und lasse mich von der Strömung treiben. Dabei filme ich alles, was ich vor die Linse bekomme. Das ist nicht selten eine Herausforderung, denn die Ufer sind im ständigen Wandel. Wo heute ein Sandstrand ist, liegt schon morgen Kies oder der Platz ist gar verschwunden.
Im Wasser finden sich fast immer Stellen, die gerne über einen Meter tief und dazwischen von Felsen umringt sind. Besonders Jungfische lieben diese Plätze. Hier gilt es den Spagat zu schaffen, einerseits das Leben einzufangen, aber andererseits kein Störenfried zu sein. Das Wichtigste: nichts wegnehmen, nichts zerstören, nur Beobachter sein. Hat man gelernt, sich in der Strömung zu halten, dauert es nicht lange und man wird umringt von Fischen, kleinen wie großen. Mit geübten Atemzügen hält man es durchaus länger unter Wasser aus und kann sich treiben lassen, dem Leben folgen. Aber man darf nie vergessen, dass die Isar ein Wildfluss ist, kein ungefährlicher Bachlauf.
»Die Flussmitte ist so gut wie immer unerreichbar.«
Das sich treiben lassen beschränkt sich immer auf wenige Meter und die Flussmitte ist so gut wie immer unerreichbar. Von außen harmlos, zeigt die Strömung im Wasser ihre gewaltige Stärke. Beide Beine auf dem Boden halten wird zur Kunst. Das ist auch für das Equipment eine große und schwierige Herausforderung. Das Letzte was man möchte ist, es zu verlieren und damit selbst zur weiteren Isarverschmutzung beizutragen. Nach fünf Jahren bin ich heute immer noch genauso begeistert, wie beim ersten Mal. Unter Wasser zu sein hat etwas Besonderes, denn nach nur einem Schritt befindet man sich in einer anderen Welt.
Doch die Schattenseiten häufen sich. Wo mich einerseits die Artenvielfalt bewegt, erschüttert mich bei meinen Reisen unter Wasser immer mehr der dort auffindbare Müll. Dazu zählen absurde Funde wie ein Controller für Spielekonsolen oder Dosen mit Kriechöl. Leere Bierflaschen zu finden gehört leider schon zur Selbstverständlichkeit. Diese Funde tauchen übrigens bereits am Stadtrand auf. Nicht selten in guter Nachbarschaft mit zurückgelassenen Schlauchbooten. Deren Besitzer*innen trennten sich nach der einmaligen Fahrt gerne von dem lästigen Besitz und liesen die Boote verweist am Ufer zurück. Nach dem nächsten Regenfall wurden diese zurück in die Isar geschwemmt und zum nächsten Stauwerk getrieben. Irgendwer wird sie schon einsammeln?
Aktionen wie „Fridays for Future“ haben gezeigt, dass die Umwelt vielen Menschen nicht egal ist. Doch wenn wir vom drohenden Klimawandel sprechen, ist dieser in unseren Gedanken immer noch ein Stück weit entfernt. Wir glauben daran, noch etwas Zeit zu haben und bald die notwendigen Vorkehrungen treffen zu können. Dabei reicht schon ein kleiner Blick an die Uferränder der Isar und man erkennt, dass wir nicht einmal unser zu Hause sauber halten können.