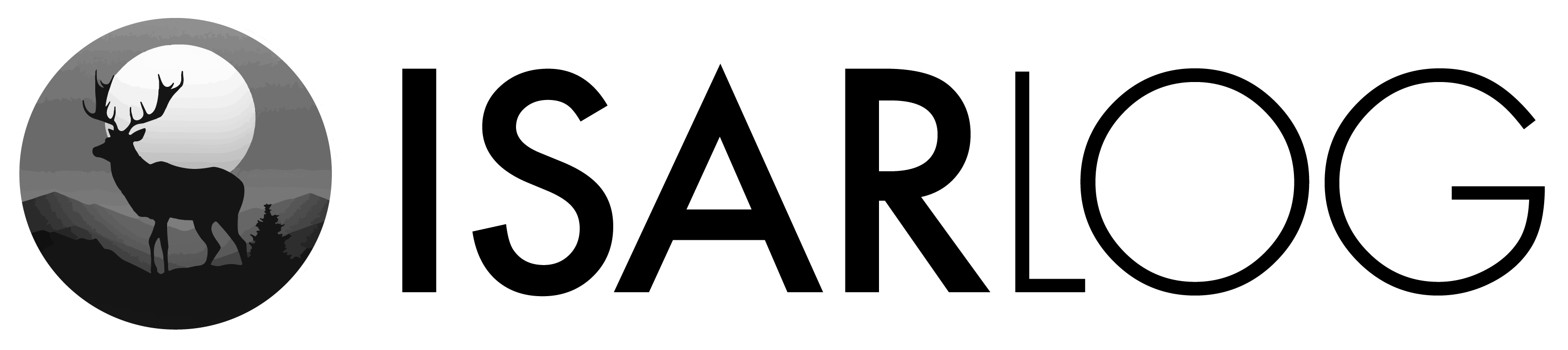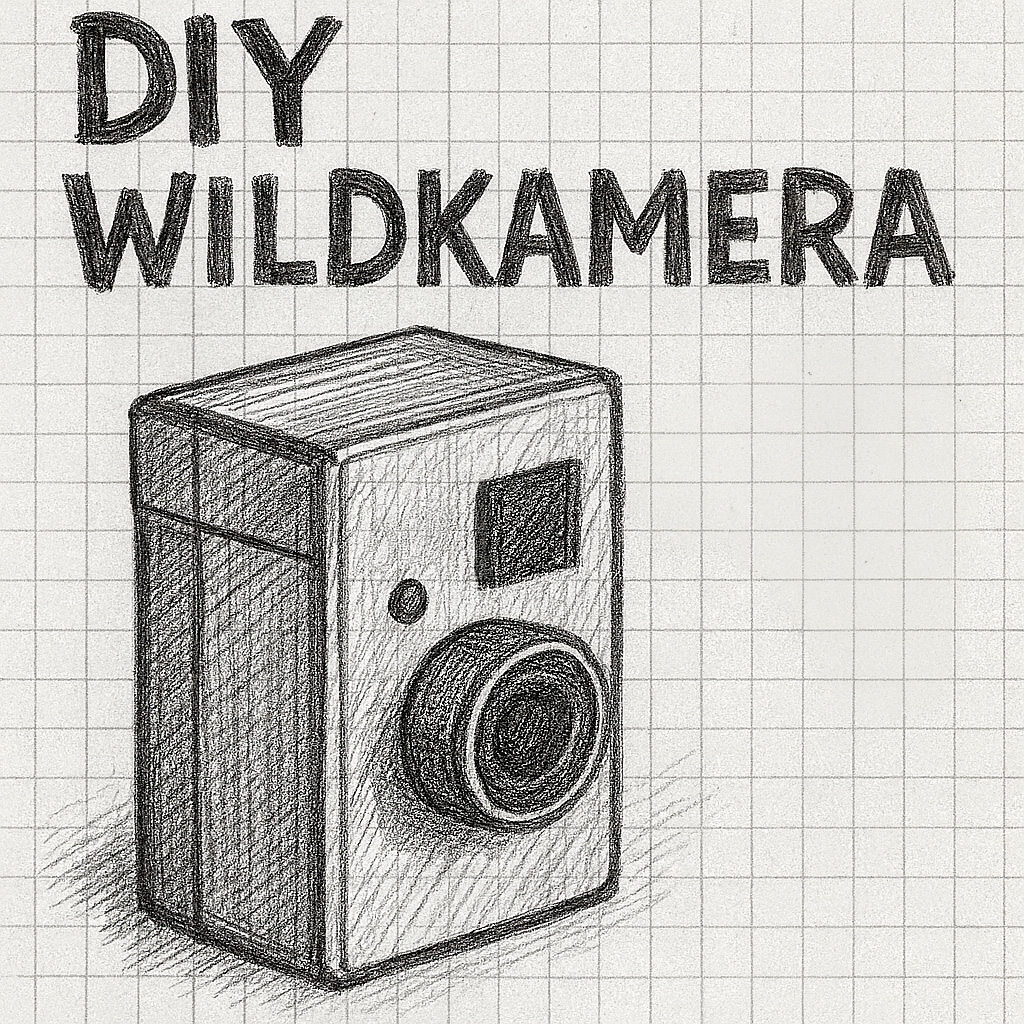Inhaltsverzeichnis

„Das Ziel ist eine DIY-Wildkamera im Taschenformat“
– Sebastian Meisinger, Isarlog
Planungsphase – Kompakt und unauffällig
Wildkameras sind für Naturbeobachtungen ein faszinierendes Werkzeug. Doch jedes Mal, wenn ich mir die Modelle im Handel angesehen habe, fiel mir das Gleiche auf: Sie sind groß, auffällig, teuer und bieten kaum Möglichkeiten zur Anpassung. Hinzu kommt, dass in unseren dicht besiedelten Gegenden selbst im Wald Diebstahl immer ein Risiko ist – und wenn eine Kamera für 100 Euro oder mehr verschwindet, ist der Ärger groß.
Darum habe ich beschlossen, meine eigene Wildkamera zu bauen. Ziel ist ein Gerät, das kaum größer als eine Spielkartenverpackung oder Powerbank ist. Die Komponentenpreise sollen so gewählt sein, dass ein Verlust verschmerzbar bleibt. Außerdem möchte ich die Kontrolle über jede einzelne Komponente haben. Mit dem 3D-Drucker kann ich Gehäuseform und Farbe frei bestimmen, sodass die Kamera deutlich harmonischer in die Umgebung passt und nicht sofort ins Auge sticht.
Die Wahl der Plattform: ESP32 statt Raspberry Pi (Pico, Zero)
Zunächst stand die Frage: welcher Controller soll das Herzstück der Kamera werden? Naheliegend wäre ein Raspberry Pi Zero gewesen – schließlich ist die Bildqualität mit den Pi-Kameras sehr gut. Doch beim genaueren Blick zeigte sich: der Zero ist für eine batteriebetriebene Wildkamera praktisch unbrauchbar. Selbst im Leerlauf verbraucht er zu viel Energie, und einen echten Deep-Sleep-Modus gibt es nicht. Eine Laufzeit von Wochen wäre damit unmöglich.
Der Raspberry Pi Pico erschien zunächst attraktiver. Er ist stromsparender, kann mit Kameramodulen kombiniert werden und hat eine breite Entwicklerbasis. Doch auch hier stößt man schnell an Grenzen: die Kameramodule sind weniger leistungsfähig, die Softwareunterstützung ist eingeschränkter und es fehlt die gewachsene Infrastruktur für einfache, stromsparende Bilderfassung.
Damit blieb der ESP32-CAM – konkret die Variante mit ESP32-S3. Er bietet eine direkte Kameraschnittstelle, Deep-Sleep mit wenigen Mikroampere Verbrauch, integriertes WiFi (für gegebenenfalls spätere Erweiterungen) und genügend Rechenleistung für die Bildaufnahme. Kurz: er vereint all das, was ich für eine ultrakompakte und effiziente Wildkamera brauche.
Energiequelle: warum LiFePO₄?
Die Wahl des Akkus war nicht minder entscheidend. Lithium-Ionen- oder Polymerakkus sind weit verbreitet, doch beide haben Nachteile: sie sind empfindlicher bei Temperaturschwankungen, altern schneller und bergen ein höheres Sicherheitsrisiko. Im Wald, bei Frost oder Sommerhitze, möchte ich keine Zelle, die im schlimmsten Fall überhitzen oder gar brandgefährlich werden könnte.
LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat) bietet für mich die beste Lösung. Die Chemie ist sicherer, die Zellen halten auch bei widrigen Temperaturen stabil durch und die Nennspannung liegt bei 3,2 Volt – ideal, weil der ESP32 mit 3,3 V arbeitet. Damit entfällt ein verlustbehafteter Spannungswandler. Mit gewählten 6000 mAh Kapazität erreiche ich vier bis sechs Wochen Laufzeit bei typischem Einsatz.
mmWave statt PIR-Sensor
Ein klassischer PIR-Sensor wäre die einfache Lösung gewesen. Doch PIR-Sensoren haben bekannte Schwächen: sie lösen bei Wind, Lichtreflexen oder vorbeifliegenden Insekten gerne falsch aus. Für eine Wildkamera, die unbeaufsichtigt im Wald hängt, sind Fehlauslösungen aber fatal – der Akku wäre schnell leer und die Speicherkarte voll mit leeren Bildern.
Die Wahl fiel daher auf einen mmWave-Sensor (LD2410S). Dieser erkennt Bewegung präziser, auch durch dünne Materialien hindurch, und unterscheidet besser zwischen echten Objekten und zufälligen Störungen. Damit ist die Kamera zuverlässiger und spart im Betrieb deutlich mehr Energie.
Temperatur und Feuchtigkeit
Zudem wird ein SHT30 Sensor (gekapselt, I²C) integriert, dieser misst die Temperatur und Feuchtigkeit der Umgebung. So erfasse ich zusätzlich Umweltbedingungen, die jede Aufnahme spannender machen.
Nachtsicht: 850 nm statt 940 nm
Eine weitere wichtige Entscheidung betraf die Infrarot-Beleuchtung. Fertige Wildkameras arbeiten meist mit 850nm, manche mit 940 nm LEDs, die völlig unsichtbar sind – aber das hat den Preis, dass die Reichweite deutlich geringer ist und die Bildqualität darunter leidet. 850 nm LEDs liefern dagegen ein helleres Bild und eine bessere Reichweite, sind aber aus nächster Nähe als leichtes Glimmen sichtbar.
Da meine Kamera so unauffällig und klein wie möglich sein soll, ist das Restrisiko akzeptabel. Auf zwei, drei Meter Entfernung ist das Glimmen kaum mehr wahrnehmbar, Tiere reagieren erfahrungsgemäß nicht darauf. Schwieriger war die Suche nach einem geeigneten Objektiv: kleine Module mit gutem Blickwinkel und gleichzeitig Nachtsichttauglichkeit sind nicht leicht zu bekommen. Hier musste ich lange vergleichen, bis eine passende Kombination gefunden war.
Wo werden die Fotos gespeichert?
Ein ESP-32 bringt von Haus aus keine Speicherfunktion für Bilder mit. Damit das möglich wird, werde ich ein gängiges MicroSD-Kartenmodul (SPI) integrieren. Die Fotos werden dann dort abgelegt.
Logik, Fehlermeldungen und Status
Damit die Kamera im Feld zuverlässig arbeitet, braucht es mehr als nur den Auslöser. Ein Selbsttest beim Start soll alle Komponenten prüfen – Kamera, Sensoren, Speicher – und meldet den Status zurück. Zwei Ebenen der Rückmeldung habe ich vorgesehen:
- eine Bi-Color LED zeigt direkt den Zustand an („Ready“ oder Fehler)
- ein OLED-Display (SSD1306, 0,96″) liefert detailliertere Informationen: ob die SD-Karte erkannt wurde, ob die Sensoren korrekt antworten oder ob ein Fehler im Ablauf vorliegt.
So gibt es sowohl eine einfache visuelle Rückmeldung im Feld als auch eine detaillierte Diagnose für den Fall, dass etwas nicht wie geplant funktioniert. Damit kann die Kamera selbstständig anzeigen, ob sie einsatzbereit ist oder ob Handlungsbedarf besteht.
Externer Helligkeitssensor
Damit die Kamera zuverlässig zwischen Tag und Nacht unterscheiden kann, wird zudem ein externer Lichtsensor verbaut. Ein einfacher Fotowiderstand auf der Hauptplatine wäre zu ungenau und anfällig für Feuchtigkeit, deshalb fiel die Wahl auf einen gekapselten Sensor, der außerhalb des Gehäuses angebracht wird. Er erkennt zuverlässig die Umgebungshelligkeit und schaltet bei einsetzender Dunkelheit automatisch die IR-LEDs zu. Durch die Auslagerung nach außen ist der Sensor wettergeschützt und liefert stabilere Werte.
Ausblick
Dies ist der erste Prototyp. Es geht mir nicht darum, sofort die perfekte Kamera zu bauen, sondern eine Basis zu schaffen, auf der ich aufbauen kann. In Zukunft lassen sich problemlos Varianten entwickeln: mit stärkerer IR-Beleuchtung, mit besserer Kamera oder mit zusätzlichen Sensoren (Temperatur, Feuchtigkeit). Der große Vorteil des DIY-Ansatzes ist genau das: ich habe die volle Kontrolle über mein System, kann jede Komponente anpassen und verbessern – und das zu einem Bruchteil der Kosten einer fertigen Kamera.
Der Preis
Damit habe ich für ca. 35 Euro eine Wildkamera geplant, die kompakter, flexibler und unauffälliger wird als vieles, was es im Handel gibt. Und das Beste: sollte sie doch einmal verschwinden, ist der Verlust verschmerzbar. Schade wäre es natürlich trotzdem. Für mich ist das der perfekte Einstieg in eine Reihe eigener, weiterentwickelter DIY-Wildkameras.
Die Teileliste
Steuerung
- ESP32-S3 Board mit Kamera-Interface
Kamera
- 2 MP: OV2640 Kamera-Modul (NoIR-Version, ohne IR-Filter) oder
- 5 MP: OV5640 Kamera-Modul (NoIR-Version, ohne IR-Filter) – alternative mit höherer Auflösung
Bewegungserkennung
- LD2410S mmWave-Sensor
Lichtsensor
- BH1750 gekapseltes I²C-Modul
Klima
- SHT30/SHT31 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (gekapselte Version, I²C)
Nachtsicht
- IR-LED 850 nm, 1 W auf Star-PCB (3 W wäre zu stromhungrig)
- Vorwiderstand 4,7 Ω, 1 W, Metallschicht
- MOSFET AO3400 (N-Kanal, Logic-Level)
- Kühlkörper für die IR-LED
Speicherung
- MicroSD-Kartenmodul (SPI, 3,3 V kompatibel)
- MicroSD-Karte (8–32 GB)
Energieversorgung
- LiFePO₄-Akku mit BMS (6000 mAh)
- TP5000 Ladeplatine (1S LiFePO₄, JST)
- Schmelzsicherung
Anzeige / Feedback
- 0,96″ OLED-Display (SSD1306, I²C, 128×64)
- Bi-Color LED (rot/grün, 3 mm, Kathode)
- Widerstände: 220 Ω
Aufbau / Mechanik
- Perfboard (Lochraster, 2,54 mm, FR4, 1,6 mm)
- Kabel, Stecker (JST)
- PETG-Gehäuse (Zigarettenschachtelgröße, 3D-gedruckt)